Wir treffen jeden Tag so viele Entscheidungen. Wie viele davon sind wirklich unsere eigenen?
Der Begriff Entscheidung wirkt, wie viele andere auch, eindeutig verständlich in seiner allgemeinen Bedeutung. Die etymologisch eindringlichste Metapher, also ein Sinnbild für das Verständnis, ist die Herkunft des Wortes aus dem germanischen Wort skaipi (Plural von skeidir für Schwertscheide).
Man stelle sich vor: zwei sich gegenüberstehende Heere, angeführt von je einem Heeresführer, warten auf den Beginn der Schlacht. Die Anzahl der Soldaten ist so gross, dass nur ein Zeichen den Beginn zum Angriff möglich macht. Ein deutliches Symbol ist, wenn der Heeresführer sein Schwert aus der Scheide zieht und für alle sichtbar in den Himmel reckt. Dann kann die Schlacht beginnen und kein Soldat wird sich nach diesem Zeichen noch einmal umdrehen, um zu schauen, ob der Heeresführer dies auch wirklich so gemeint hat.
Das Zeichen zum Angriff ist also ultimativ und damit ohne jede Varianz in der Auslegung. Diese Konsequenz ist zwar allgemeiner Konsens, logisch und in der Theorie auch so akzeptiert, allerdings scheint es, dass die individuelle Auslegung und damit die tatsächliche Bereitschaft, eine Entscheidung ohne jeden Ausweg zu akzeptieren, durchaus nur mit Einschränkungen so gesehen wird.
Unsere Gegenwart ist in den meisten gesellschaftlichen Bereichen durch weiche Grenzen bzw. durch die Optionen eines späteren Eingriffs gekennzeichnet. Dieses Format der Möglichkeiten ist neben einer kulturellen, vor allem eine technische Errungenschaft. Wenn wir die sozialen bzw. psychologischen Dimensionen und Implikationen einen Moment aus der Betrachtung nehmen, dann ist der Blick auf die Evolution der unterschiedlichen Technologien ein wichtiger Barometer für die zunehmende Konsequenzlosigkeit unserer Alltagskultur.
In nahezu allen Lebensbereichen unserer mitteleuropäischen Lebenswirklichkeit ist eine Entscheidung auf der einen Seite eingebettet in einen alltäglichen Erfahrungs- und Leistungskanon, der das Resultat (als das zu erwartbare Ergebnis einer Entscheidung) im Grunde vorwegnimmt, also das Risiko einer falschen Entscheidung extrem minimiert; auf der anderen Seite sind die nutzbaren Umfeldbedingungen so klar auf einen möglichst positiven Ausgang der getroffenen Entscheidung zugeschnitten, dass auch hier die Konsequenz (immer im Hinblick auf eine existenzielle, lebensbedrohliche Situation, die entstehen könnte) deutlich reduziert wird.
Lakonisch gesagt, wir leben in einer 20-Grad-Kultur, ohne Unebenheiten unter uns und mit der permanenten Sicherheit immer auf eine imaginäre Undo-Taste drücken zu können.
Im eigentlichen Sinn ist eine Entscheidung aber ein Risiko. Jede Überquerung einer Strasse, jeder Biss in eine Stück Brot, jede Nutzung eines Verkehrsmittel, jede Form einer intentionalen Aktivität eines Menschen, also eine gerichtete Aktivität, ist im Kern immer latent unsicher in Bezug auf den Ausgang.
An anderer Stelle haben wir über das Thema Gewohnheit spekuliert bzw. diesen Begriff vertiefend betrachtet. Wenn wir von der Tatsache ausgehen, dass Menschen alles zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihrem Leben zum ersten Mal tun, dann ist jede Wiederholung verbunden mit der immanenten Versicherung, dass es beim letzten Mal ja auch schon gut gegangen ist.
Im Zusammenhang der Evolution ist die Aussage, man hat es überlebt, was der Homo sapiens vor ca. 40.000 Jahren jeden Tag konkret erlebte, für unsere Gegenwart in der Dimension sicher nicht mehr zu erwarten. Unser übliches Risikospektrum ist mit einer Einschätzung wie zum Beispiel es hat dann doch noch gut genug geklappt, weitgehend ausgereizt.
Der Mensch rekapituliert im Nachgang einer Entscheidung und bewertet, meistens sicher unbewusst, die Qualität des Ergebnisses für das eigene Motiv und damit die Überprüfung seiner Motivation, also das, was erreicht werden sollte.
Vor allem aber generiert das Individuum fraktale Erfahrungen. Fraktal, da diese, vergleichbar mit einem Fragment, in einem grösseren Zusammenhang sortiert bzw. organisiert und damit auch wieder für eine vergleichbare Situation abrufbar sind.
Darüber hinaus geht es auch um die Selbstähnlichkeit der Erfahrung zu einer anderen, einer Erfahrung, die in einem vergleichbaren Kontext gemacht wurde.
Ich nenne diese Erfahrungsbündel auch Sets of Experiences.
Sie entsprechen zueinander eben durch ihre Ähnlichkeit, aber auch ihre Nützlichkeit und ihre generelle Vergleichbarkeit. Solche Sets, man könnte sie auch Cluster nennen, sind ein grundlegender Faktor für unsere (Über-) Lebensfähigkeit, da sie ähnlich einem Hologramm die einzelnen Fragmente [Bruchstücke] des Gelernten und Erfahrenen permanent in einen Abgleich zueinander bringen.
Müssten Menschen jede Entscheidung von Grunde auf komplett eruieren und evaluieren, dann würden sie in der Bewegungsunfähigkeit verharren, da alles nicht nur fremd, sondern eben auch nicht in die jeweilige Lebensanforderung eingeordnet werden könnte.
Im Zusammenhang einer Entscheidung muss demnach eine Form der Repitition eingeleitet werden. Menschen wiederholen das Erfahrene, das, was funktionierte. Ganz nach dem Prinzip von es hat schon einmal funktioniert, daher entscheide ich mich nun wieder dafür.
Diese Aussage ist relativ schwach, gewinnt aber auf einer anderen Ebene der Betrachtung, da man sich leicht vorstellen kann, wie sich nichts exakt wiederholen lässt. Jede Situation ist neu, wenn auch nur mit kleinen Unterschieden, jede Bedingung ist anders und jede, lapidar gesagt, [kaum beeinflussbare] Gemütslage ist eben auch nicht planbar und damit variant zu der letzten.
Streng genommen ist daher eine exakte und eindeutige Repitition dessen, dass man davor einmal gemacht und damit entschieden hat, schlicht nicht möglich. Mit einem Schuss Poesie kann man sagen, dass dies der spannende und virulente Teil von Leben ist.
Virulenz bedeutet Giftigkeit. Bleiben wir daher bei dem poetischen Motiv und sagen: Das Leben erhält vielleicht sein Potenzial zur permanenten Entwicklung durch die richtige Dosierung des uns umgebenden (virulenten) Risiko.
Leben ist die Entwicklung von Potenzial durch die richtige Dosierung des uns umgebenden Risiko.
Letztlich, wenn wir davon ausgehen, dass ein exaktes Wiederholen eben grundsätzlich nicht machbar ist, sprechen wir eher von der Permutation, einer Aktivität, die im Grundsatz immer in einen Erfahrungskontext eingebettet sein muss, damit sie überhaupt innerhalb einer gewissen [lebensrelevanten] Geschwindigkeit getroffen werden kann.
Menschen permutieren ihre Entscheidungen in der Form, dass sie zwar in der Sache identischer bleiben, aber gleichzeitig als Variante, mehr oder weniger, getestet werden müssen.
Ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Vorgang nicht wirklich bewusst geschieht, oder zumindest nur in sehr selten Fällen. Vielmehr glaube ich, Menschen gehen tatsächlich davon aus, dass sie etwas als eindeutige Entität, also einer abstrakten, eben exakt so zugewiesenen Bedeutung für das, was entschieden wurde, meinen. Diese Eindeutigkeit in der subjektiven Wahrnehmung ist mir als Feststellung sehr wichtig. Warum?
Es wäre schwer zu ertragen, dass sich alles permanent, auch in den alltäglichsten Entscheidungsumfeldern, ändert, da das Gefühl der damit verbundenen Sicherheit elementar für die Beiläufigkeit einer Entscheidung ist. Schlicht aus dem Grund, weil wir immer in jeder Lebenssituation etwas entscheiden.
Darüber hinaus ist genau dieser [psychologische] Punkt jene Stelle menschlichen Konstitution, die sich der (manchmal bewussten, oft unbewussten) Manipulation von aussen aussetzt.
Vermutlich wäre dem menschlichen Individuum die Perpetuierung sehr viel lieber. Perpetuieren, meint die Stetigkeit des Bekannten, des Erfahrenen, des [erwiesenermaßen] Sicheren.
Dieser Balanceakt zwischen dem subjektiven Bedürfnis nach Konstanz und der verführerischen Ebene, dass sich etwas verändert hat, dass irgendetwas Neues, Spannendes und damit Fortschreitendes möglich wurde, ist wohl ein sehr wichtiger Aspekt, wenn wir uns hier gedanklich mit dem Phänomen einer menschlichen Entscheidung beschäftigen.
An anderer Stelle wird die Relevanz heutiger Technologien, vor allem digitaler Medien, auf die menschliche Fähigkeit zur Entscheidung und damit der Risikobereitschaft vertiefend betrachtet.
In Vorwegnahme dazu kann man feststellen, dass wir in unserer kybernetisch geprägten Kultur zu einem Grad der Externalisierung unserer menschlichen Fähigkeiten neigen, die im Umkehrschluss eben zu einer Abhängigkeit von eben jenen Technologien führen, welche logischerweise die Sorge um das, was passieren könnte, dominieren. Aus dem Grund, da die konkrete eigene Erfahrung und damit die Übung einer Fähigkeit umgangen bzw. von einer technischen (meist digitalen) Instanz (device) abgenommen wird.
Letztlich geht es dabei um einen fortschreitenden Prothesen-Effekt. Eine Prothese ist ein aus der körperlichen Perspektive externes Hilfsmittel, ein artifizieller Ersatz für eine verlorene Fähigkeit. Eine Brille ist eine Prothese für die schwache Sehleistung. Eine Krücke für die Einschränkung beim Gehen. Ein Einlage in den Schuhen eine Hilfe für die Haltung bzw. einem Rückenleiden.
Soweit klar. Wir würden wohl nicht dazu neigen, dass wir unsere Kleidung als eine Prothese dafür bezeichnen würden, dass wir mit der Kälte bzw. dem Wetter generell ein Problem hätten. Wir würden vermutlich auch nicht dazu neigen, ein Fahrrad als eine Prothese für unsere Langsamkeit zu betrachten.
Jedoch war der Mensch in seiner evolutionären Entwicklung (sicher noch relativ nahe am Stadium des Affen) bis zu einem gewissen Punkt ohne Kleidung, der Stoffwechsel des Körpers konnte die Temperatur problemlos ausgleichen.
Einige körperliche Einschränkungen wurden zu dieser Zeit nie erreicht, da die geringere Lebenserwartung dies in der Regel verhinderte.
Die Frage ist nun, ab welchem Zeitpunkt bzw. in welcher Situation der Mensch etwas als einen Mangel erlebt bzw. diesen als solchen wahrnimmt. Es ist klar, dass man den Begriff der Prothese sicher kritisch diskutieren kann. Das hier genannte Fahrrad ist daher mit diesem Begriff eher experimentell gemeint. Aber es geht um ein experimentelles Gedankenspiel, daher bleiben wir bei diesem Beispiel.
Ab wann also ist der Mensch der Wahrnehmung erlegen, dass er zu langsam wäre, dass es besser sein könnte, wenn er sich schneller bewegen würde?
An dieser Stelle soll nur der Aspekt der damit verbundenen Entscheidung betont werden. Menschen scheinen eine Notwendigkeit, einen Mangel, ein Bedürfnis (auch in dieser eskalierenden Reihenfolge gemeint), in jedem Fall aber einen Anlass für eine intrinsisch oder extrinsisch getroffene Entscheidung zu benötige
Jedes Thema erhält mehr Prägnanz, wenn man die Perspektive provokativer und damit extremer gestaltet: Wenn ein Mensch nun einen Teil seines Körpers verliert, sagen wir durch einen Unfall, dann ist man (auch wenn die Geschichte der Prothesenfertigung über ungefähr 4.000 Jahre erzählt werden könnte), seit den letzten 100 Jahren auf einem hohen Niveau in der Lage, artifizielle Körperteile für den Menschen mit einer hohen Perfektion auszustatten und damit die natürlichen Möglichkeiten zu simulieren.
Gehen wir also davon aus, jemand hätte seinen rechten Arm verlogen und wir spekulieren über den letzten technologischen Stand der Sensorik, der Robotik, Unterstützung durch künstliche Intelligenz und optimale Werkstoffe generell.
Wer würden auf die Idee kommen, einen komplett anderen Arm zu entwerfen und zu produzieren, als das natürliche Vorbild?
Wer würde auf die Idee kommen, dass der Arm komplett flexibel bewegt werden könnte, sich in der Länge verändern lässt, unterschiedliche Handmodule angebracht werden könnten oder die Prothese bestimmte Bewegungsabläufe lernen würde, die dann ohne Steuerung durch den Menschen erfolgt. Vor allem der letztgenannte Ansatz wäre gespenstisch. Zumindest für die Mehrheit.
Gleichzeitig wird vielen schnell klar werden, dass Menschen sich durchaus einiges davon in der Zukunft vorstellen könnten.
Zurück zur theoretischen Betrachtung. Der kleine Umweg zum Thema [kybernetisch, vor allem digital getriebene] Externalisierung menschlicher Fähigkeiten ist vor allem wichtig, wenn wir uns den Prozess einer Entscheidung (Entscheidungsfindung) näher betrachten.
Allgemein steigt der sogenannte Informationsgrad mit der Qualität der Information und damit der Quelle, aber auch mit der Dauer, in welcher diese Informationen für die ausstehende Entscheidung gesammelt werden können.
In der Theorie entwickelt sich der Informationsgrad, indem man die individuell notwendigen Informationen durch die konkret notwendigen Informationen teilt.
Anders ausgedrückt könnte man allerdings auch sagen, dass die Reduktion der konkret vorhandenen Informationen auf die relevante Menge der tatsächliche benötigten Informationen der eigentliche Hebel für die Qualität einer Entscheidung wichtig ist.
Diese Ergänzung scheint wichtig, da die Frage nach den tatsächlich benötigten Informationen nicht klar beantwortet wird und im Maßstab heute zugänglicher, vor allen digitalen, Quellen durch inflationäre Maßlosigkeit gekennzeichnet ist.
Genau an dieser Stelle wird unsere kybernetische Welt so bedeutsam. Nimmt man die inzwischen schon klassisch zu nennende [digitale] Suchmaschine Google, dann führt ein Begriff wie hier thematisiert: Entscheidung in 0,32 Sekunden zu 82.200.000 Einträgen. Es ist leicht nachvollziehbar, dass die Prüfung dieser Information nahezu unmöglich erscheint. Es wird klar, dass man, würde man alle gefundenen Einträge sichten wollen, den Rest (oder darüber hinaus) der verbleibenden Lebenszeit nutzen müsste, vor allem aber liegt es in der Natur des Angebotes, dass jeder Mensch damit komplett überfordert ist.
Dies ist ein triviales und auch eher popularisierendes Beispiel. Wenn wir aber diese Quelle (Google) als den gegenwärtigen Standard des global zugänglichen Wissen bezeichnen, dann wird deutlich, dass hier ein relevanter Anteil an dem Potenzial der eigenen Fähigkeit zum Überblick der Informationsbeschaffung in Bezug auf die tatsächliche Verwertung und (dies ist die eigentliche Konzession an das Werkzeug) an die qualitative Auswahl dessen, was schliesslich die Basis für die Entscheidung darstellt, an eine externe Instanz (eben der Suchmaschine) abgegeben wird.
Es stellt sich dabei logischerweise die Frage, was dann der eigene und souveräne Anteil der Entscheidung ist, aber auch welche Möglichkeiten der Manipulation werden dadurch eröffnet.
Es ist nur scheinbar eine banale Perspektive, folgt man der Frage, wie die Informationsbeschaffung verläuft, wenn man seine eigene Kuh melkt, um Milch trinken zu können, oder wenn man vor dem Spektrum der angebotenen Milchsorten eines typischen Supermarktes steht. Diese Frage könnte man auch in folgender Hypothese fixieren:
Die Menge der verfügbaren Informationen und Möglichkeiten reduziert die Bereitschaft einer individuellen Entscheidung und führt zur Externalisierung in standardisierte, vor allem digitale Hilfsmittel.
Wir sprachen über den Prozess einer Entscheidung. Vorab dazu: Die Theorie unterscheidet zwischen vollkommener Information (100 %), unvollkommener Information (0 – 100 %) und vollkommener Ignoranz (0 %).
Aus meiner Perspektive ist das eine rein abstrakte Position und sehr irreführend, da sowohl die Vollkommenheit als auch das Fehlen jeder Information nicht möglich ist. Das Spektrum dessen, was letztlich über die Möglichkeit zur Überschaubarkeit und damit eben auch die Wahrnehmbarkeit (Perceptibility) entscheidet, ist vor allem durch zwei Faktoren definiert:
Zum einen die vorliegende Kompetenz des Individuums zur Filterung und damit zur zielführenden Reduktion der Informationen für einen optimalen Prozess und damit auch die Qualität der Entscheidung.
Zum anderen die Komplexität des Themas, der Aufgabe, also der Herausforderung, zu welcher eine Entscheidung getroffen werden muss.
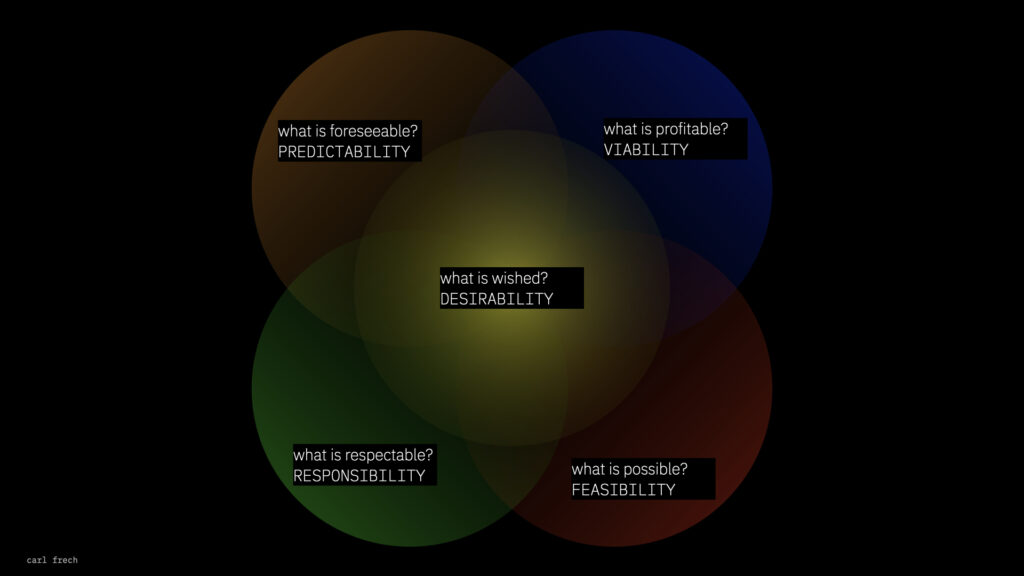
In der Kombination dieser beiden Faktoren könnte man defnieren:
Die Qualität einer getroffenen Entscheidung verläuft reziprok zwischen der Komplexität der Herausforderung und der Kompetenz des Individuums, das die Entscheidung trifft.
Umgekehrt kann man sagen, ist die Komplexität geringer, ist weniger Kompetenz nötig, um einen höheren Wirkungsgrad, also den positiven Effekt zu erzielen. Die Steigung dieses Winkels ist letztlich der Gradmesser für Erfolg, Qualität und damit die Zufriedenheit über das Ergebnis der Entscheidung, die getroffen wurde.
Das ist im Grundsatz selbstverständlich und bekommt seine Besonderheit erst durch den Grad der Skalierung und der Distanz zum Thema selbst. Daher ein einfaches Beispiel:
Wenn ich ein Spiegelei in der Pfanne zubereiten will, ist die Komplexität (Herausforderung) relativ gering. Ich kann dieses Problem, also die damit verbundenen Entscheidungen mit wenig Kompetenz lösen. Der Winkel des Erfolges ist daher sehr früh sehr steil.
Das gleiche Ei kann aber auch komplizierter zubereitet werden: Egg Florentine, Egg Benedict, Rührei en cocottes, shakshuka, usw.. Die Kompetenzanforderungen steigen also in Referenz und Relation. Trotzdem, diese Beispiele sind mit Blick auf unserem Kulturkreis immer noch leicht nachvollziehbar.
Bleiben wir bei dem Ei und wechseln den Kulturkreis. Jeder Wechsel in einen anderen sozialen bzw. kulturellen Zusammenhang produziert automatisch Fremdheit und im Umkehrschluss die Chance für etwas Neues. In Japan gibt es eine lange Tradition der Eierzubereitung und hier zum Beispiel das Onsen Ei. Jede und jeder, der aufgefordert wird, ein typisches Onsen Ei zuzubereiten, wird hier vermutlich passen.
Es fehlt die Kompetenz, es fehlen die äusseren Bedingungen, es fehlt vor allem jedes grundlegende Verständnis. Letztlich ist dies aber der Status jeder Form von Lernen. Auch für ein Kind, das zum ersten mal ein Spiegelei zubereitet hat, ist diese Erfahrung magisch, ein Erfolg, welcher kaum zu überbieten ist.
Schauen wir einfach in die Augen von Kindern, die zum ersten Mal diese Erfahrung gemacht haben.
Ich habe weiter oben die Korrelation zwischen Kompetenz und Komplexität genannt und bis zu dem Beispiel mit den Eiern ausgeführt. Einen essenziellen Faktor habe ich jedoch unterschlagen. Den Faktor Zeit.
Wenn die Geschwindigkeit, also die Relation zwischen dem Beginn eines Prozesses und seines Abschlusses (Ergebnis) keine Rolle spielen würde, dann hätte jedes Instrument, das die Menschheit zum Zweck der Einsparung von Zeit erfunden hat, keine Bedeutung. Aber genau das Gegenteil dominiert unsere moderne Kultur der vergangenen wenigen Jahrhunderte.
Alle (externalisierten) Instrumente, seien sie nun digital optimiert oder nicht), sind durch das Merkmal der Geschwindigkeit determiniert. Die Einsparung von Zeit ist überwiegend der Faktor ihres Erfolges und damit der Nukleus dafür, warum sie zwingend erfolgreich werden mussten.
Noch einmal am Beispiel eines einfachen Taschenrechners: Hätte die Biologie nicht jedem Organismus eine eingeschränkte Lebenszeit verordnet, hätten wir unendlich viel Zeit, würde dann ein Taschenrechner für uns Sinn machen?
Eine interessante Frage.
Aber bleiben wir noch einen Moment bei der Kernfrage:
Was ist eine Entscheidung?
Wir haben festgestellt, jede Entscheidung muss immer auf der Grundlage unvollkommener Informationen getroffen werden. Nun ist (wenn auch als Hypothese) klar, das Spektrum beginnt nie bei 0 % und endet nie bei 100 %. Der Korridor, innerhalb welcher der Entscheidungsprozess stattfindet, liegt dazwischen. Für die Einschätzung dieses Korridors ist vermutlich exakt jene Kompetenz und damit Erfahrung notwendig, die die Erreichbarkeit eines Zieles ermöglicht.
Das bedeutet auch, dass die Unterscheidbarkeit generell eingeschätzt werden muss.
Der Kybernetiker Heinz von Foerster, 1911 – 2002, sagt dazu treffend:
Nur die Fragen, die prinzipiell unentscheidbar sind, können wir entscheiden.
Heinz von Foerster, österreichischer Physiker, Kybernetiker und Philosoph.
Dieses Zitat von Heinz von Foerster ist elementar für die weitere Betrachtung, da er damit die provokative Aussage trifft, dass der Mensch seine individuelle Bedeutung gerade dadurch manifestiert, dass er die (Deutungs-) Hoheit der Entscheidung für sich in Anspruch nimmt. Nun möge man gerne denken, dass extrem viel von dem, was wir jeden Tag in unserem Leben entscheiden, weit davon entfernt ist, dass dies tatsächlich nur von uns entschieden werden könnte. Das ist sicher richtig und gerade die typischen (vor allem digitalen) Hilfsmittel machen dies sehr treffend und eindringlich deutlich.
Aber es ist eben die ökonomische, die kulturelle wie auch die soziale Singularität der menschlichen Existenz (als Spezies), welche uns die Deutungshoheit in eigener Sache erlaubt, geradezu aufzwingt, wir also entscheiden können. Anders gefragt:
Wer sollte sonst entscheiden?
Heinz von Foerster führt uns mit der Unauflösbarkeit der von ihm getroffen Aussage vor Augen, dass wir eben nur jene Fragen wirklich entscheiden können, die im Prinzip unentscheidbar sind, wir in der Konsequenz aber auch die Verantwortung dafür tragen müssen, denn nur wir können und haben die Antwort dazu gegeben (als Ausdruck unserer existenziellen Isolation).
Exakt dieser Fokus führt uns wieder zur Grundfrage der Entscheidung zurück bzw. erweitert diese um den Zusatz:
Wollen wir tatsächlich die Verantwortung für eine Entscheidung übernehmen, die wir alleine treffen müssen?
Wir können uns entspannen. Diese Dimension einer Entscheidung ist durch uns selten zu treffen. Wir sind in den meisten Fällen eingebunden in ein sozial-kollektives Konstrukt und folgen der Logik und Erfahrung unserer Sippe, aus der wir stammen. Die meisten Wege, die wir im Leben gehen, folgen einem Pfad, den andere schon gegangen sind. Das war nicht immer so.
Als Seefahrer wie Vasco da Gama, 1469 – 1524, im 15.-Jahrhundert mit ihrem Schiff in einer geraden Linie in Richtung des Horizonts ihren Heimathafen verlassen haben, war noch nicht klar, dass die Erde keine Scheibe ist.
Es ist schon klar: Wir treffen jeden Tag Entscheidungen und wollen uns auch die Fähigkeit dafür nicht infrage stellen lassen. Wir nehmen für uns die vorab schon so bezeichnete Deutungshoheit in Anspruch. Wir haben die ökonomischen, die kulturellen und die sozialen Fähigkeiten dafür entwickelt bzw. viel dafür seit unserer Geburt gelernt, dass wir dafür die Kompetenz haben.
Aus der Perspektive einer gesunden erwachsenen Person ist so eine Aussage klar, fast zu klar. Wenn man allerdings den Zyklus des Lebens, die radialen [Bewegung] Möglichkeiten eines Individuums in den ersten Wochen, Monaten und Jahren betrachtet und dann wieder die immer geringer werdenden Optionen zum Ende des Lebens betrachtet, verändert sich die Perspektive.
Wenn man im Blick hat, dass es auch situative Einschränkungen gibt, welche uns, zum Beispiel nach einem Unfall (wir sind an einen Ort gebunden), durch ökonomische (wir haben unsere Arbeit verloren) oder durch soziale Veränderungen (wir werden Eltern), in unseren Entscheidungsvarianten einschränken, dann wird deutlich, dass eine Entscheidung im Prinzip immer neu getroffen wird und sich, bei noch so grosser Ähnlichkeit, von der bereits getroffenen unterscheide.
Mit einer maximalen und etwas trivialen Verkürzung könnte man mit Gregory Bateson [2], 1904 – 1980, sagen:
The difference that makes a difference.
Der Unterschied, der einen Unterschied macht.
Gregory Bateson, angloamerikanischer Anthropologe, Biologe, Sozialwissenschaftler, Kybernetiker und Philosoph.
Gregory Bateson hat diesen radikalen Satz als generalistischer Denker formuliert. Seine Position, vor allem, wenn man die Zeit vor Augen hat, in der er seine grundlegenden Arbeiten präsentierte, kann man vor allem als Freigeistigkeit bezeichnen. Er hat sich der Einordnung in ein festes Konstrukt, schon gar nicht der Festlegung als wissenschaftliche Theorie Zeit seines Lebens entzogen. Einer seiner bekannten Schüler und war Paul Watzlawick, 1921 – 2007, der vor allem den Ansatz eines integrativen Ansatzes von Wissenschaft im Zusammenspiel praktischer Anwendungsszenarien übernommen hat. Im weiteren wird es einen eigenen Text zu Gregory Bateson geben. Er selbst hat den Satz The difference that makes a difference in einem etwas rustikalen Beispiel illustriert:
Man kann einem Hund einen Tritt geben, dass der Hund wegfliegt, oder man kann ihm einen Tritt geben, dass er wegrennt. Im ersten Fall gibt man die Energie, die den Hund bewegt, im zweiten Fall leistet der Hund seine Bewegung selbst, das heisst, man hat ihm nur Information gegeben, die bewirkt, dass er seine eigene Energie verwendet. Im ersten Fall muss der Hund nichts verstehen, im zweiten Fall muss er verstehen, was ich meine. Er muss also nicht nur seine eigene Energie aufwenden, sondern auch noch interpretieren, wie er das tun soll.
Wie gesagt, wir werden uns noch intensiver mit Gregory Bateson beschäftigen. Das Zitat und die Interpretation formuliert jedoch eindringlich und leicht nachvollziehbar die Bedeutung der Intention in Bezug auf eine Entscheidung. Es macht deutlich, dass der Begriff vor allem einer ist, der nur kulturell, kommunikativ und in dem Zusammenhang auch ethisch verstanden werden kann, da sonst die Bedeutung im Gravitationsfeld der Natur schnell verloren geht. Da wir aber nur aus dieser Perspektive letztlich darüber entscheiden können, was Entscheidung bedeutet, noch ein letzter Gedanke zum Thema.
Wie schon gesagt, jede Entscheidung, sei diese auch noch so minimal und eingebettet in einen routinierten Tagesablauf, durchläuft einen Prozess. Folgende Phasen als Vorschlag dafür:
Wahrnehmung der Notwendigkeit.
Relevanz für die konkrete Situation.
Risikoabschätzung bei ausbleibender Entscheidung.
Beachtung der erreichbaren Umfeldfaktoren (-Informationen).
Berücksichtigung erwünschter und unerwünschter Effekte.
Durchführung und Berücksichtigung möglicher Alternativen.
Erfolgskontrolle und Speicherung der Aktivität.
Man diesen Ablauf auf unterschiedliche Prozesse im alltäglichen Leben generalisieren (reduzieren). Man könnte damit auch eine Abfolge für das Prinzip Lernen verstehen. Man könnte damit auch die Entscheidungsmatrix einer institutionellen Organisation vermuten. Man könnte damit auch über den Prozess spekulieren, welche Entscheidung man bei der Klimaveränderung treffen sollte. Oder, ganz im Kleinen, man könnte auch den Alltag mit Kindern und die damit verbundene Erziehung (besser: Beziehung und Konsequenzen) im Blick haben.
Jede Betrachtung und gedankliche Vertiefung erhält ihre Potenz, also ihren geometrischen Wert durch die Erkenntnis eines Musters. Wie immer geht es um die Fähigkeit der Kontextkompetenz [x] und der damit einhergehenden Möglichkeit, kausale Zusammenhänge nicht nur zu verstehen, sondern diese auch mit einem Ziel zu verbinden.
Wer doch lieber auf Papier lesen möchte, findet hier das PDF.
© Carl Frech, 2020
Die Nutzung dieses Textes ist wie folgt möglich:
01 Bei Textauszügen in Ausschnitten, zum Beispiel als Zitate (unter einem Zitat verstehe ich einen Satz oder ein, maximal zwei Abschnitte), bitte immer als Quelle meinen Namen nennen. Dafür ist keine Anfrage bei mir notwendig.
02 Wenn ein Text komplett und ohne jede Form einer kommerziellen Nutzung verwendet wird, bitte immer bei mir per Mail anfragen. In der Regel antworte ich innerhalb von maximal 48 Stunden.
03 Wenn ein Text in Ausschnitten oder komplett für eine kommerzielle Nutzung verwendet werden soll, bitte in jedem Fall mit mir Kontakt (per Mail) aufnehmen. Ob in diesem Fall ein Honorar bezahlt werden muss, kann dann besprochen und geklärt werden.
Ich setze in jedem Fall auf Eure / Ihre Aufrichtigkeit.
